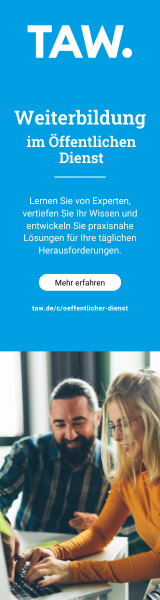Ausgabe 2/2012, Januar
Abhandlungen
-
Bardo Fassbender, München, Optimismus und Skepsis im Völkerrechtsdenken der Gegenwart – Zur Bedeutung von „Denkschulen“ in der Völkerrechtswissenschaft
Zwei Hauptrichtungen bestimmen die völkerrechtliche Lehre der Gegenwart: Einerseits eine „völkerrechtsfreundliche“ Richtung, zu deren Programm die Verbreiterung und Vertiefung des völkerrechtlichen Normenbestands, der Ausbau internationaler Institutionen sowie ein wirksamer internationaler Schutz der Menschenrechte gehört. Und andererseits eine „völkerrechtsskeptische“ Richtung, welche die Schwächen der Völkerrechtsordnung betont, die Rolle des Einzelstaats dagegen positiv sieht. Der folgende Beitrag beleuchtet diese beiden Richtungen und ihre geschichtlichen Vorläufer und ordnet ihnen bestimmte „Denkschulen“ zu, darunter die „Lehre von der internationalen Gemeinschaft“ und den völkerrechtlichen Konstitutionalismus, die beide wesentlich von deutschen Autoren geprägt worden sind. Das Völkerrechtsdenken hat sich über lange Zeit zwischen den Polen von Fortschrittsglauben und Skeptizismus, Gemeinschaftsausrichtung und Staatszentriertheit entwickelt, steht womöglich heute aber an einem Wendepunkt.
-
Diana Zacharias, Heidelberg, Religionsfreiheit und Bestattungsrecht
Die kommunalen Friedhofsträger sehen sich zunehmend mit religiös begründeten Sonderwünschen in Bezug auf die Art und Weise der Bestattung von Leichnamen konfrontiert. Der Beitrag zeigt auf, welche Anforderungen das Grundrecht der Religionsfreiheit aus Art. 4 GG an das Bestattungswesen stellt, wie das geltende Friedhofs- und Bestattungsrecht ihnen Rechnung trägt und wie mögliche Kollisionslagen aufgelöst werden können.
-
Doris Böhme, Bamberg, Die direkte Abwahl von Bürgermeistern
Am 18. Mai 2011 hat der nordrhein-westfälische Landtag den Gesetzentwurf zur Änderung des § 66 GO NRW in zweiter Lesung angenommen und verabschiedet. Nach einer kontroversen Diskussion im Kommunalausschuss des Landtags ist nun neben Brandenburg, Sachsen und Schleswig-Holstein auch in Nordrhein-Westfalen die Einleitung eines Abwahlverfahrens durch die Bürger gegen einen amtierenden Bürgermeister möglich. Dieses direktdemokratische Element, welches im Vergleich zu Direktwahlen oder sachpolitischen Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden in der wissenschaftlichen Betrachtung wenig Aufmerksamkeit erfahren hat, fand erst nach 1990 Eingang in die Kommunalverfassungen der Flächenländer der BRD und wird seitdem in unterschiedlichem Ausmaß in den Kommunen angewendet.
-
Alexander Peters, Speyer, Art. 15 GG und die Notverstaatlichungen von Banken
Die Finanz-, Wirtschafts- und Bankenkrise ab 2007 zwang den Staat, in Not geratene Banken zu verstaatlichen, um Schlimmeres zu verhindern. Die aktuelle Staatsschulden-, Währungs- und Bankenkrise zeigt, dass notgedrungene Bankenverstaatlichungen weiterhin nicht ausgeschlossen werden können. Der folgende Beitrag macht deutlich, dass Art. 15 GG dem Gesetzgeber für solche Not- und Krisenzeiten weitgehende Handlungsreserven bietet.
Bericht
-
Marcus Dittrich, Speyer, Kommunalfinanzen nach/in der Krise? – Tagungsbericht zu den Speyerer Kommunaltagen am 6. und 7. Oktober 2011
Buchbesprechungen
- Edoardo Chiti/Bernardo Giorgio Mattarella (Hrsg.), Global Administrative Law and EU Administrative Law – Relationships, Legal Issues and Comparison (Gernot Sydow)
- Johann Bader/Michael Funke-Kaiser/Thomas Stuhlfauth/Jörg von Albedyll, Verwaltungsgerichtsordnung; 5., neu bearb. Auflage (Jürgen Held)
- Günter Frankenberg, Staatstechnik – Perspektiven auf Rechtsstaat und Ausnahmezustand (Margrit Seckelmann)