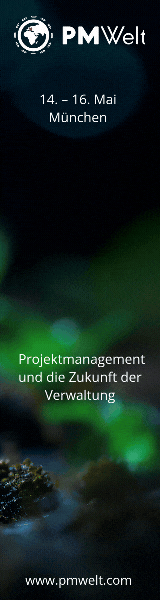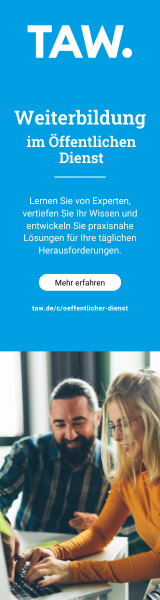Ausgabe 6/2025, März
Abhandlungen
-
Claudia Hainthaler, Heidelberg, Extremistische Abgeordnete – neutrale Richter? – Zum Umgang mit (vormaligen) AfD-Politikern auf der Richterbank
Der Wiedereintritt ehemaliger AfD-Bundestagsabgeordneter in den Richterdienst hat die Justizverwaltung und die Politik in jüngerer Zeit vor Herausforderungen gestellt. Es existieren zwar mehrere Verfahrensoptionen, um Richter aus dem aktiven Dienst zu entfernen. Im Falle der Politikrückkehrer kollidieren dabei aber die Freiheit des Mandats und die Unabhängigkeit der Richter mit dem Schutz der Funktionsfähigkeit der Rechtspflege sowie der verfassungsmäßigen Ordnung. Der Beitrag skizziert diesen verfassungsrechtlichen Rahmen und erörtert in dessen Licht die einzelnen in Betracht kommenden Maßnahmen in Gestalt von Richteranklage, gerichtlichem Disziplinarverfahren sowie der Versetzung im Interesse der Rechtspflege.
-
Karl-Heinz Ladeur, Hamburg, Beschleunigung und Verbesserung der Raum- und Fachplanung durch Digitalisierung?
Die Krise des Planungsrechts, die an der Krise der Großprojekte sichtbar wird, ist eine Erscheinungsform des immer wieder beschworenen „Stillstands“ in Deutschland. Die Steigerung der Komplexität der großen Planungsverfahren ist an eine Grenze gestoßen. Abhilfe könnte die Digitalisierung des Planungsrechts versprechen, die längerfristig den Übergang zu einem neuen Paradigma der Planung erlauben würde, das die Beherrschung der Komplexität vom Einsatz intelligenter Computer erwarten würde.
-
Jonas von Zons, MĂĽnchen, RĂĽstungsexporte als Verletzung grundrechtlicher Schutzpflichten?
Der Krieg zwischen der Hamas und Israel beschäftigt nicht nur seit geraumer Zeit die politische Debatte, sondern mittlerweile auch die Gerichte in Deutschland. Rüstungsexporte bilden dabei seit jeher einen politisch empfindlichen Sachbereich. Unlängst ist verschiedentlich der Versuch unternommen worden, die Genehmigungen solcher Ausfuhren nach Israel unter Behauptung einer Verletzung grundrechtlicher Schutzpflichten gerichtlich untersagen zu lassen. In der Sache geht es dabei um eine individualrechtlich eingekleidete Gestaltung der deutschen Außenpolitik. Die Verfahren blieben erwartungsgemäß erfolglos, bergen sie doch gravierende Probleme im Hinblick auf den Grundsatz der Gewaltenteilung.
-
Joram-B. Brandau/Anna-Mira Brandau, Münster/Erfurt, Der Bundeszwang als „schärfstes Schwert“ der Konfliktlösung zwischen Bund und Ländern – Im Spannungsfeld zwischen föderaler Stabilität und Verfassungsautonomie
Der Bundeszwang gilt als das „schärfste Schwert“ der Konfliktlösung im föderalen Gefüge Deutschlands. Er ist in der bundesdeutschen Geschichte noch nie zum Einsatz gekommen. Aktuelle politische Entwicklungen, im Besonderen der Bedeutungszuwachs autoritär-populistischer Parteien wie der „Alternative für Deutschland“ (AfD), deuten allerdings auf eine mögliche Aufgabe der bisherigen Zurückhaltung hin. Doch könnte eine unüberlegte Anwendung des Bundeszwangs verheerende Folgen für das Vertrauen in die föderale Staatsordnung haben. Hier setzt der Beitrag an. Nach einer Abklärung des prinzipiellen Stellenwerts des Bundeszwangs in der bundesstaatlichen Ordnung plädiert er für ein differenziertes Verständnis dieses Instruments und analysiert dessen Funktionsweise im Spannungsfeld zwischen föderaler Stabilität und Verfassungsautonomie.
Buchbesprechung
- Carsten Schucht/Gerd Wiebe, Die neue EU-Produktsicherheitsverordnung (Matthias Wiemers)
Rechtsprechung
- BVerfG, Urteil vom 14.1.2025 – 1 BvR 548/22 – Erhebung von Polizeikosten bei Hochrisikospielen