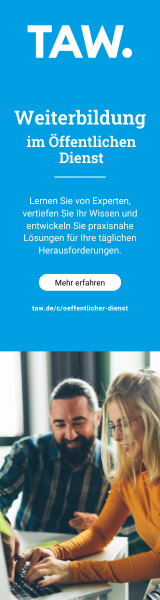Ausgabe 5/2016, MĂ€rz
Abhandlungen
-
Margrit Seckelmann, Speyer/Wolfram Lamping, Darmstadt, Verhaltensökonomischer Experimentalismus im Politik-Labor â Rechtliche Rahmenbedingungen und Folgerungen fĂŒr die Evaluationsforschung
Helmuth Schulze-Fielitz hat die EinfĂŒhrung âweicherâ Steuerungsformen einmal mit der zugespitzten Frage begleitet, ob der Leviathan nunmehr auf dem Weg zum ânĂŒtzlichen Haustierâ sei. Im Zuge des verhaltensökonomischen Nudge-Ansatzes, der in diesem Artikel vorgestellt werden soll, appellieren öffentliche Akteure zunehmend u.a. an den Spieltrieb ihrer BĂŒrger, um diese zu einem Verhalten zu bringen, das zu ihrem âeigenen Bestenâ sei. Ist der Leviathan nunmehr auf dem Weg zur KindergĂ€rtnerin? Soll und darf sich die Regierung verhaltensökonomischer Mittel zur Gestaltung der Entscheidungsarchitektur bedienen â oder soll sie â wie es Udo Di Fabio kĂŒrzlich ausgedrĂŒckt hat â ânicht an uns herumpsychologisierenâ, sondern nur âsagen, was Sacheâ sei?
-
Minou Banafsche, Kassel, Die Friedensfunktion sozialstaatlicher GewÀhrleistungen
Das Sozialrecht unterliegt einem doppelten Rechtfertigungszwang: Es muss einerseits einen leistungsrechtlichen Mindeststandard gewĂ€hrleisten, ohne dabei andererseits die Gemeinschaft der Beitrags- bzw. Steuerzahler im ĂbermaĂ zu beanspruchen. Die damit angesprochenen InteressengegensĂ€tze bergen nicht selten ein erhebliches Konfliktpotenzial. Dem versucht das Sozialrecht im Wege der Definition von Leistungen und Leistungsgrenzenâ mittelbar auch in Form von Mitwirkungspflichten, denen der Leistungsberechtigte, will er sich nicht dem Risiko der Leistungsversagung oder des Leistungsentzugs aussetzen, nachzukommen hat Rechnung zu tragen. Hier setzt der nachfolgende Beitrag an und stellt die Frage, ob und ggf. in welchem Umfang das Sozialrecht â konzeptionell wie tatsĂ€chlich â in der Lage ist, die unterschiedlichen Interessen zu einem â gerechten â Ausgleich zu bringen und auf diese Weise friedensstiftend zu wirken. Erfolgen soll dies am Beispiel des Rechts auf GewĂ€hrleistung eines sozioökonomischen Existenzminimums, das in besonderem MaĂe geeignet ist, die beschriebenen Konfliktlinien offenzulegen.
-
Michael Kawik, MĂŒnster, Streikverbot fĂŒr Beamte? â Ist das mit Art. 33 Abs. 5 GG fĂŒr Beamte begrĂŒndete Verbot, die nĂ€here Ausgestaltung des DienstverhĂ€ltnisses mit kollektiven KampfmaĂnahmen durchzusetzen, noch zu rechtfertigen?
Mit seiner Entscheidung vom 27. Februar 2014 hat das Bundesverwaltungsgericht die alte Diskussion um ein Streikrecht der Beamten neu entfacht. Es hĂ€lt ein generelles Verbot fĂŒr unvereinbar mit der auch in der europĂ€ischen Menschenrechtskonvention gewĂ€hrleisteten Koalitionsfreiheit und sieht Handlungsbedarf fĂŒr den Gesetzgeber. Ist aber die Aufgabe des ĂŒber die hergebrachten GrundsĂ€tze des Berufsbeamtentums begrĂŒndeten Verbots â zumindest fĂŒr bestimmte Beamtengruppen â nun zwingende Folge des Urteils? Vor dem Hintergrund, dass das Bundesverfassungsgericht eindeutige Vorgaben zur Angemessenheit der Beamtenbesoldung getroffen hat, ist der wichtigste Anlass zum Streik, der Kampf um bessere Bezahlung, relativiert. Zudem wird mit der ggf. auch sukzessiven EinrĂ€umung des Streikrechts an den ĂŒber Art. 33 Abs. 5 GG bestimmten Grundfesten â Streikverbot als hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums â des Dienstrechts gerĂŒttelt.
Buchbesprechungen
- Klaus Schönenbroicher/Andreas Heusch, Ordnungsbehördengesetz Nordrhein-Westfalen, Kommentar: Gesetz ĂŒber Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden â OBG NRW (Cristina Fraenkel-Haeberle)
- Walter Frenz, Europarecht; 2. Auflage (Alexander Schink)
Umfangreiche Rechtsprechung in LeitsÀtzen
- AusgewÀhlte Entscheidungen im Volltext finden Sie hier:
- 91. EGMR, Urteil vom 26.11.2015 â Beschwerde Nr. 3690/10 â Annen â Anprangern von Abtreibungen; MeinungsĂ€uĂerungsfreiheit
- 92. EuGH, Urteil vom 17.12.2015 â C-157/14 â Neptune Distribution â Angaben zum Salzgehalt von Mineralwasser
- 95. BVerwG, Urteil vom 14.10.2015 â 9 C 11.14 â Haftung fĂŒr Gewerbesteuerschulden
- 98. BVerwG, Beschluss vom 17.9.2015 â 2 A 9.14 â Bundesnachrichtendienst; Einstellung; Beurteilungsspielraum der zustĂ€ndigen Stelle bei der SicherheitsĂŒberprĂŒfung
- 103. BVerwG, Beschluss vom 1.10.2015 â 6 B 15.15 â Orientierung an Einstellungsvoraussetzungen fĂŒr öffentlichen Schuldienst als Voraussetzung der Anerkennung von Ersatzschulen
- 105. BVerwG, Urteil vom 14.10.2015 â 6 C 17.14 â Fernsehwerbung; Schutz der Zuschauer vor der Verwechslung von Werbung und Programm
- 106. BVerwG, Urteil vom 10.9.2015 â 4 C 3.14 â Haftung fĂŒr sanierungsrechtlichen Ausgleichsbetrag
- 107. BVerwG, Beschluss vom 2.11.2015 â 4 B 32.15 â Bordell; Gewerbebetrieb; VergnĂŒgungsstĂ€tte
- 113. BVerwG, Urteil vom 27.10.2015 â 1 C 32.14 â Frist fĂŒr Aufnahmeersuchen im Dublin-Verfahren nicht drittschĂŒtzend
- 114. BVerwG, Urteil vom 28.10.2015 â 2 C 23.14 â Keine Klagebefugnis gegen die Nichtheranziehung zu WehrĂŒbungen