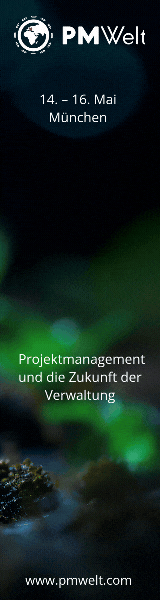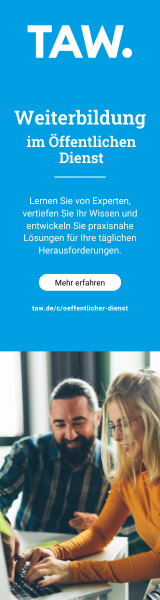Ausgabe 23/2024, Dezember
Abhandlungen
-
Claas Friedrich Germelmann, Hannover, Der internationale und europäische Rahmen für den Klimaschutz in der Energieversorgung
Für die Ausgestaltung der Energieversorgungssysteme gibt es weder auf völkerrechtlicher noch auf europarechtlicher Ebene abschließende und kohärente rechtliche Vorgaben. Im Gegenteil stehen sich mit Klimaschutz, Energieversorgungssicherheit und sozialen Gesichtspunkten teils miteinander in Konflikt stehende Zielsetzungen gegenüber. Die internationale und die europäische Rechtsordnung enthalten allerdings in unterschiedlichem Umfang Anhaltspunkte für einen rechtlichen Ausgleich der Zielkonflikte. Hieran haben sich insbesondere der europäische und der nationale Gesetzgeber zu orientieren, wenngleich ihnen weiterhin Gestaltungsspielräume verbleiben.
-
Michael Goldhammer, Wiesbaden, Flucht ins „Zensururheberrecht“? - Staatliche Geheimhaltung durch Immaterialgüterrecht vor dem Verwaltungsgericht
Der seit einiger Zeit im Immaterialgüterrecht verbreitete Begriff des „Zensururheberrechts“ steht stellvertretend für einen Einsatz von Immaterialgüterrechten durch Hoheitsträger, der nicht ganz ohne Grund als staatliche Kommunikationsregulation problematisiert wird. Das jüngst deutlich zunehmende Fallmaterial wirft die Frage auf, ob derzeit in jeder Hinsicht effektiver Rechtsschutz geboten wird. Im Anschluss an eine entsprechende Diskussion im Immaterialgüterrecht befasst sich der Beitrag mit der Frage, wie die Verwaltungsgerichte hier ins Spiel gebracht werden können, um der erheblichen Grundrechtsrelevanz Rechnung zu tragen.
-
Martin Heckel, Gotha, Recht in der Transformationsgesellschaft - Zur Rezeption der Grundrechtsbindung im Beitrittsgebiet
Der Beitrag betrifft die Rezeption der Grundrechtsbindung im Beitrittsgebiet. Hier könnte die Grundrechtsbindung der öffentlichen Verwaltung, auf die der Beitrag beschränkt ist, faktisch noch nicht vollends rezipiert worden sein. Die tatsächliche Wirksamkeit von Art. 1 Abs. 3 GG sollte deshalb näher untersucht werden.
-
Mirjam Scherle, Augsburg, Neuere legislative Entwicklungen bei BegrĂĽndungspflichten fĂĽr die untergesetzliche Rechtsetzung - Impulse fĂĽr eine generelle BegrĂĽndungspflicht?
§ 9 Abs. 8 BauGB enthält seit Langem eine sehr prominente Anordnung einer Begründungspflicht für die untergesetzliche Normsetzung. Obwohl im Grundsatz bislang anerkannt war, dass keine Begründungspflicht für die untergesetzliche Rechtsetzung besteht (I.), hat der Gesetzgeber in jüngerer Zeit zunehmend Verpflichtungen zur Veröffentlichung von Begründungen in Ermächtigungsgrundlagen für untergesetzliche Normen aufgenommen (II.). An dieser Entwicklungstendenz setzt der Beitrag an. Er analysiert zunächst die jeweiligen konkreten Begründungsanforderungen (III.) und die damit verfolgten Ziele (IV.). Anschließend geht er der Frage nach, ob sich aus der auffälligen Häufung solcher Vorschriften Rückschlüsse auf die Existenz einer generellen Begründungspflicht für die untergesetzliche Rechtsetzung ziehen lassen (V.).
Buchbesprechung
- Claudia Hainthaler, Die Sicherung der Werteunion (Helmut Goerlich)
Rechtsprechung
- BVerwG, Urteil vom 6.6.2024 – 3 C 5.23 – Einschreiten der Straßenverkehrsbehörde gegen verbotenes Gehwegparken
Umfangreiche Rechtsprechung in Leitsätzen
- Ausgewählte Entscheidungen im Volltext finden Sie hier:
- 661. EuGH, Urteil vom 26.9.2024 – C-768/21 – Land Hessen – EntschlieĂźungsermessen der Datenschutz- Aufsichtsbehörden bei festgestellten Datenschutzverstößen    Â
- 662. BVerfG (Kammer), Beschluss vom 7.8.2024 – 2 BvR 418/24 – Gerichtliche Aufklärungspflichten im Konkurrenteneilverfahren    Â
- 663. VGH BW, Beschluss vom 7.8.2024 – 2 S 184/24 – ErschlieĂźungsrechtliches Planerfordernis    Â
- 664. BVerwG, Beschluss vom 24.7.2024 – 2 VR 5.23 – Vorverwendung mit FĂĽhrungsfunktion    Â
- 665. BVerwG, Beschluss vom 14.8.2024 – 6 VR 1.24 – Vereinsrechtliches Verbot eines Medienunternehmens – COMPACT    Â
- 667. BVerwG, NK-Urteil vom 24.4.2024 – 8 CN 1.23 – Rechtmäßigkeit einer Satzungsänderung zur Auflösung eines von einer Kommune betriebenen GroĂźmarkts    Â
- 669. OVG NRW, NK-Urteil vom 16.5.2024 – 10 D 236/21.NE – Bebauungsplan; Aufstellungsbeschluss; räumliche Festlegung des Geltungsbereichs    Â
- 670. OVG Rheinl.-Pf., Urteil vom 26.6.2024 – 8 A 10427/23.OVG – BeseitigungsverfĂĽgung mit Fristsetzung    Â
- 671. OVG NRW, Urteil vom 1.7.2024 – 10 A 1487/22 – Eintragung eines Prozessionsweges in die Denkmalliste    Â
- 675. OVG NRW, Beschluss vom 27.6.2024 – 20 A 838/20 – Untersagung einer Alttextiliensammlung    Â
- 676. BayVGH, Urteil vom 14.7.2024 – 14 B 22.2576 – Ersatzpflanzungsauflage auf Grundlage einer kommunalen Baumschutzverordnung bei Erteilung einer Fällgenehmigung von als nicht erhaltungswĂĽrdig angesehenen Bäumen    Â
- 677. OVG NRW, Urteil vom 26.7.2024 – 8 D 169/22.AK – Immissionsschutzrechtliche Genehmigung fĂĽr die Errichtung und den Betrieb einer Windenergieanlage; Unrichtigkeit einer Rechtsbehelfsbelehrung    Â
- 678. VGH BW, Beschluss vom 19.8.2024 – 10 S 232/24 – Rauch- und Geruchsemissionen durch ein Holzkohlegrillrestaurant; Anordnung im Einzelfall    Â
- 679. OVG NRW, Urteil vom 16.5.2024 – 11 A 1429/23 – Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis fĂĽr die Aufstellung eines Altkleidersammelcontainers    Â
- 680. OVG NRW, Urteil vom 26.6.2024 – 11 A 2101/23 – Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis fĂĽr die Aufstellung eines Altkleidersammelcontainers    Â
- 681. OVG NRW, Urteil vom 26.6.2024 – 11 A 2239/23 – Ăśbertragung der StraĂźenbaulast auf eine Anstalt öffentlichen Rechts    Â
- 682. BVerwG, Urteil vom 13.6.2024 – 1 C 5.23 – Unionsrechtliches FreizĂĽgigkeitsrecht neben anderweitigem Aufenthaltsrecht möglich    Â
- 683. HambOVG, Beschluss vom 23.7.2024 – 6 Bs 36/24 – Reichweite des Beschwerdeausschlusses des § 80 AsylG    Â
- 684. VGH BW, Beschluss vom 22.8.2024 – 11 S 1064/23 – Wirkungen des Einreise- und Aufenthaltsverbots    Â
- 685. BVerwG, Urteil vom 22.2.2024 – 5 C 7.22 – Staatliche Finanzierung kirchlicher Kindertageseinrichtungen nach dem nordrhein-westfälischen Kinderbildungsgesetz 2016    Â
- 686. VGH BW, Urteil vom 1.8.2024 – 6 S 254/23 – Transportverbot fĂĽr nicht abgesetzte Kälber; Verbandsklage auf Erlass einer AllgemeinverfĂĽgung    Â
- 687. OVG NRW, Beschluss vom 11.7.2024 – 4 A 1764/23 – Ablehnung des Wiederaufgreifens des Verfahrens bezĂĽglich eines Corona-Soforthilfe-Schlussbescheids    Â
- 688. OVG NRW, Beschluss vom 12.7.2024 – 4 B 1116/23 – RĂĽckforderung ĂĽberzahlter Fördermittel nach dem Europäischen Sozialfonds    Â
- 689. HambOVG, Beschluss vom 2.8.2024 – 4 Bf 232/23.Z – Wiederholte Zwangsgeldfestsetzung    Â
- 690. VGH BW, Beschluss vom 13.8.2024 – 14 S 925/24 – Akteneinsicht gemäß §§ 20, 22 BVerfGG; Verwaltungsrechtsweg; Beiladung
-
   Â