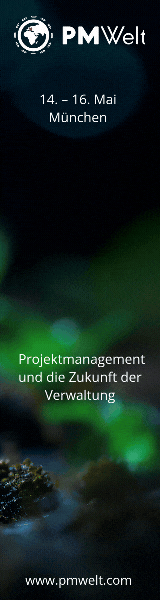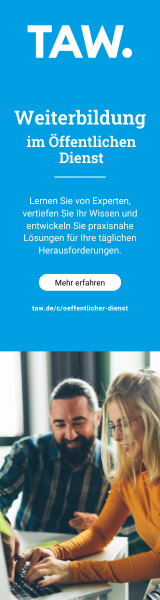Ausgabe 14/2025, Juli
Abhandlungen
-
Michael Kloepfer/Alexander Jessen, Berlin, Obergesetze: eine neue Ebene in der Normenhierarchie?
Die Gesetzgebung ist nach traditioneller Auffassung u.a. davon geprägt, dass sich der parlamentarische Gesetzgeber grundsätzlich nicht durch einfaches Recht selbst binden kann. Gleichwohl bestehen in der Rechtsordnung stellenweise Ausnahmen von diesem Grundsatz. Es handelt sich hierbei dann um Obergesetze, die im Rang zwischen Verfassung und einfachem Recht stehen. Die formale Etablierung von solchen Obergesetzen könnte dem Gesetzgeber insbesondere eine Möglichkeit zur wirksamen Übernahme von Langzeitverantwortung unabhängig von jeweils bevorstehenden Wahlen einräumen und dadurch eine nachhaltigere Gesetzgebung ermöglichen. Aktuelle politische – und rechtliche – Bedeutung erlangt die Frage nach Obergesetzen derzeit im Rahmen des Projekts der Sozialisierung großer Wohnungsunternehmen im Wege eines angestrebten „Vergesellschaftungsrahmengesetzes“ in Berlin. Der Beitrag untersucht die allgemeinen rechtlichen Voraussetzungen und die Natur von Obergesetzen und beleuchtet in diesem Zusammenhang rechtspolitische Erwägungen zur Einführung von Obergesetzen.
-
Malte Stemkowitz, Passau, Politisches Neutralitätsgebot im Bundestag? - Über Diskursräume und Amtsautorität
Der Beitrag befasst sich mit den dogmatischen Grundlagen des (partei-)politischen Neutralitätsgebots und setzt sich mit der ungeklärten Frage auseinander, ob es Regierungsmitglieder und deren Äußerungsbefugnisse auch im Deutschen Bundestag beschränkt. Dabei zeigt sich, dass wesentliche Argumente, mit denen das (partei-)politische Neutralitätsgebot begründet wird, nicht auf den Bundestag als besonderen Diskursraum übertragen werden können.
-
Fritz Schäfer, Hamburg, Vereinsverbote als Hebel zur Einschränkung von Meinungsäußerungen - Das Kennzeichenverbot aus verfassungsrechtlicher Perspektive
Der Beitrag beleuchtet eine Eigentümlichkeit des strafrechtlichen Kennzeichenverbots. Dieses sanktioniert Meinungsäußerungen nicht wegen ihres konkreten Aussagegehalts, sondern weil sie abstrakt auf eine verbotene Organisation verweisen. Auf diese Weise drohen verfassungsrechtliche Anforderungen der Meinungs- und Vereinigungsfreiheit ausgehebelt zu werden. Das wird anhand von zwei Beispielen verdeutlicht: der Diskussion um die Strafbarkeit des Slogans „From the River to the Sea“ und der vor allem mit Blick auf die Kennzeichen von Rockergruppen verabschiedeten Änderung des § 9 Abs. 3 VereinsG.
-
Simon Diethelm Meyer/Fiete Kalscheuer, Kiel, Das Grundrecht auf finanziellen Neubeginn - Zur Verfassungswidrigkeit von § 302 Insolvenzordnung
Aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG folgt ein Grundrecht auf finanziellen Neubeginn. Dieses Grundrecht umfasst das Recht eines jeden Menschen, nach einer Insolvenz in einem gewissen zeitlichen Rahmen vollständig entschuldet zu werden. Der Beitrag beleuchtet die verfassungsrechtlichen Grundlagen des Grundrechts auf finanziellen Neubeginn und legt dar, weshalb die Ausnahme bestimmter Forderungen von der Restschuldbefreiung gemäß § 302 InsO verfassungswidrig ist.
Buchbesprechungen
- Elisabeth Kaneza, Rassische Diskriminierung in Deutschland (Ekkehard StrauĂź)
- Dirk Freudenberg/Kai von Lewinski (Hrsg.), Handbuch Bevölkerungsschutz (Matthias Wiemers)
Umfangreiche Rechtsprechung in Leitsätzen
- Ausgewählte Entscheidungen im Volltext finden Sie hier:
- 381. EuGH, Urteil vom 29.4.2025 – C-181/23 – Kommission/Malta – EinbĂĽrgerung von Drittstaatsangehörigen gegen eine im Voraus festgelegte Zahlung oder Investition    Â
- 382. EuGH, Urteil vom 30.4.2025 – C-63/24 – Galte – Ausschluss von der Anerkennung als FlĂĽchtling    Â
- 384. BVerwG, Beschluss vom 11.10.2024 – 5 PA 1.23 – Zuständigkeit des Gesamtpersonalrats in Abgrenzung zur Zuständigkeit des Personalrats der Zentrale beim BND    Â
- 385. BVerwG, Beschluss vom 4.3.2025 – 2 B 42.24 – Milderungsgrund der „Entgleisung während einer negativen, inzwischen ĂĽberwundenen Lebensphase“    Â
- 386. OVG NRW, Beschluss vom 27.1.2025 – 34 A 66/23.PVL – Anspruch auf sächliche Ausstattung von Personalratsmitgliedern    Â
- 389. HambOVG, Beschluss vom 20.3.2025 – 3 Bs 29/25 – Wahlen zum Studierendenparlament der Universität Hamburg    Â
- 390. OVG NRW, Urteil vom 14.1.2025 – 5 A 855/22 – Feststellung der Rechtswidrigkeit einer Sperrung des Zugverkehrs an einem Bahnhof im Vorfeld einer Versammlung    Â
- 391. VGH BW, Beschluss vom 9.4.2025 – 6 S 460/24 – Auswirkungen einer formwechselnden Umwandlung auf eine personenbezogene gewerberechtliche Erlaubnis    Â
- 392. OVG LSA, Beschluss vom 20.3.2025 – 3 L 134/24 – Zum Auskunftsanspruch eines Insolvenzverwalters gegenĂĽber einer gesetzlichen Krankenkasse zur Vorbereitung eines Anfechtungsbegehrens    Â
- 393. BVerwG, Urteil vom 8.1.2025 – 11 A 24.23 – AusfĂĽhrung eines Teilabschnitts einer Höchstspannungsleitung als Erdkabel    Â
- 394. BVerwG, Urteil vom 15.1.2025 – 11 A 5.24 – Planfeststellung; Entschädigung fĂĽr die Beeinträchtigung einer bergrechtlichen Bewilligung    Â
- 396. OVG NRW, Beschluss vom 20.2.2025 – 10 B 978/24 – Wirkung von Nebenbestimmungen gegen Rechtsnachfolger    Â
- 399. BVerwG, Urteil vom 23.1.2025 – 7 C 4.24 – Betriebsbeschränkungen fĂĽr Windenergieanlagen zum Lärmschutz; Bestimmung des Einwirkungsbereichs nach Nr. 2.2 TA Lärm    Â
- 400. BVerwG, Beschluss vom 5.3.2025 – 7 B 19.24 – Aufhebung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung    Â
- 402. OVG NRW, Beschluss vom 7.2.2025 – 22 B 92/25.AK – Erteilung eines Vorbescheids zur Errichtung und zum Betrieb von zwei Windenergieanlagen; Vorwegnahme der Hauptsache    Â
- 405. BVerwG, Urteil vom 19.12.2024 – 7 A 14.23 – Wasserrechtliche Erlaubnis zur Einleitung von Abwasser aus dem Betrieb einer schwimmenden Speicher- und Regasifizierungsanlage (FSRU) in die Jade    Â
- 407. BayVGH, Beschluss vom 24.3.2025 – 11 CE 25.212 – Zustimmung der Fahrerlaubnisbehörde zur Teilnahme an einem Kurs zur Wiederherstellung der Fahreignung von alkohol- oder drogenauffälligen Kraftfahrern    Â
- 408. BVerwG, Urteil vom 27.2.2025 – 1 C 13.23 – Chancen-Aufenthaltsrecht bei Minderjährigkeit    Â
- 413. BVerwG, Urteil vom 12.12.2024 – 5 C 1.23 – Jugendhilfe; Erstattung von Aufwendungen fĂĽr Beiträge zu einer gesetzlichen Rentenversicherung    Â
- 415. BVerwG, Beschluss vom 6.2.2025 – 20 F 11.23 – Geheimhaltung im Interesse des Bundes
-
   Â