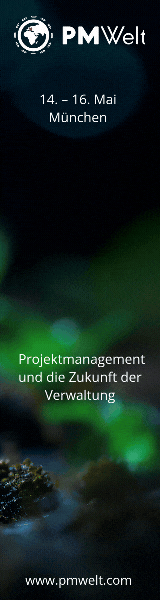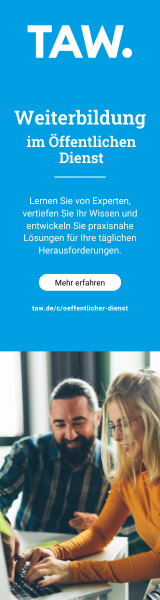Ausgabe 13/2025, Juli
Thematischer Schwerpunkt: Mit BeitrĂ€gen zu den JubilĂ€en der preuĂischen und sĂ€chsischen Verwaltungsgerichtsbarkeit
Abhandlungen
-
Detlef Merten, Speyer, Vor einhundertfĂŒnfzig Jahren: PreuĂisches Oberverwaltungsgericht
Vier Jahre nach der ReichsgrĂŒndung 1871 errichtet PreuĂen ein Oberverwaltungsgericht als höchste Instanz fĂŒr Verwaltungsstreitigkeiten. Es ist mit unabhĂ€ngigen, lebenszeitigen Richtern besetzt und unterscheidet sich so von der Verwaltungsrechtspflege. Seine Rechtsprechung gilt als liberal und eigenstĂ€ndig, wofĂŒr neben anderen die âWeberâ-Urteile stehen, die eine Premiere des Werks ermöglichten. Das âKreuzbergâ-Urteil beschrĂ€nkt die vage polizeiliche Generalklausel, die unter dem hochqualifizierten PrĂ€sidenten Bill Drews schĂ€rfere Konturen erhĂ€lt. Sein Senat entscheidet den Fall des âBorkum-Liedsâ zutreffend, weil er die antijĂŒdischen Vers-SĂ€nger als Störer ausmacht. Drewsâ 1927 publiziertes Polizeirechts-Lehrbuch gerĂ€t zum Klassiker, und er prĂ€gt auch das Polizeiverwaltungsgesetz von 1931, dessen § 14 Vorbild wird. Bis 1937 kann das Gericht rechtsstaatliche Standhaftigkeit mitunter durch listige Argumentation beweisen. Sein Niedergang endet im Jahre 1941 mit der Eingliederung in ein Reichsverwaltungsgericht.
-
Dirk Tolkmitt, Leipzig, SpĂ€t kommt sie, doch sie kommt! â Die EinfĂŒhrung der Verwaltungsgerichtsbarkeit im Königreich Sachsen vor 125 Jahren
Das Königreich Sachsen zĂ€hlte im 19. Jahrhundert zu den bedeutendsten Mittelstaaten Deutschlands. Seine jahrhundertealte Tradition im Bergbau und HĂŒttenwesen begĂŒnstigte die um 1800 einsetzende Industrialisierung, aus der das Land als Zentrum der Textilproduktion und des Maschinenbaus hervorging. Eine Entwicklung, die wichtige Kodifikationen auf dem Gebiet des materiellen Verwaltungsrechts nach sich zog. Das System des Rechtsschutzes gegen behördliche MaĂnahmen zeigte sich hingegen von der rasanten UmwĂ€lzung der Lebenswelten zunĂ€chst unbeeindruckt. Betrachtet man die Phase der Etablierung verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutzes in Deutschland, die schon 1864 in Baden eingesetzt hatte, aber erst nach GrĂŒndung des Deutschen Reiches richtig Fahrt aufnahm, fĂ€llt ein Aspekt sofort ins Auge: SĂ€mtliche GroĂ- und Mittelstaaten Deutschlands, auch Ăsterreich, hatten sich in einem relativ engen Zeitfenster zwischen 1864 und 1879 eine Verwaltungsgerichtsbarkeit gegeben. Nur das Königreich Sachsen brauchte weitere mehr als 20 Jahre, bis auch hier mit dem Gesetz ĂŒber die Verwaltungsrechtspflege vom 19. Juli 1900 Strukturen geschaffen wurden, die dem modernen VerstĂ€ndnis gerichtlichen Rechtsschutzes entsprechen. Dieser Befund wirft naturgemÀà Fragen auf. Welchen UmstĂ€nden war diese Verzögerung geschuldet? Und fĂŒhrte sie im Gegenzug zu einem höheren Niveau des Rechtsschutzes im Vergleich mit anderen Bundesstaaten?
-
Valérie V. Suhr, Hamburg, Gefahr gebannt? Reform zum Schutze des Bundesverfassungsgerichts
Ende 2024 wurden das Grundgesetz (GG) sowie das Bundesverfassungsgerichtsgesetz (BVerfGG) geÀndert, um das Bundesverfassungsgericht resilienter zu machen. Vor dem Hintergrund eines national wie international zu beobachtenden Wachstums an nationalistischen Parteien geht es um nicht weniger als den Schutz der deutschen Demokratie und des deutschen Rechtsstaats insgesamt. Dieser Beitrag skizziert und erlÀutert die GesetzesÀnderungen, diskutiert möglichen weiteren Reformbedarf und ordnet die Reform verfassungsrechtlich ein.
-
Martin Israng, Berlin, Reform der Rechtsförmlichkeit â Die 4., vollstĂ€ndig ĂŒberarbeitete Auflage des Handbuchs der Rechtsförmlichkeit bringt insbesondere fĂŒr die Ănderungsrechtsetzung des Bundes grundlegende rechtsförmliche RegelĂ€nderungen
Im Mittelpunkt des folgenden Beitrags steht die Ende des Jahres 2024 erschienene, vollstĂ€ndig ĂŒberarbeitete Neuauflage des vom Bundesministerium der Justiz herausgegebenen Handbuchs der Rechtsförmlichkeit. Die Neufassung sieht insbesondere fĂŒr die Ănderungsrechtsetzung grundlegende Ănderungen vor, die hier vorgestellt werden. Zugleich wird der Frage nachgegangen, ob das mit der Neuauflage verfolgte Ziel der Vereinfachung rechtsförmlicher Regeln erreicht wurde.
Umfangreiche Rechtsprechung in LeitsÀtzen
- AusgewÀhlte Entscheidungen im Volltext finden Sie hier:
- 341. EuGH, Urteil vom 27.3.2025 â C-217/23 â Laghman â FlĂŒchtlingseigenschaft; Begriff der Zugehörigkeit zu einer âbestimmten sozialen Gruppeâ    Â
- 342. EuGH, Urteil vom 3.4.2025 â C-807/23 â Jones Day â Ausbildung von RechtsanwaltsanwĂ€rtern; territoriale BeschrĂ€nkungen    Â
- 343. EuGH, Urteil vom 3.4.2025 â C-283/24 â Barouk â Erfordernis einer Ex-nunc-PrĂŒfung des Antrags auf internationalen Schutz    Â
- 344. EuGH, Urteil vom 10.4.2025 â C-607/21 â Ătat belge â Aufenthaltsrecht des Verwandten in gerader aufsteigender Linie, dem Unterhalt gewĂ€hrt wird    Â
- 345. BVerfG (Kammer), Beschluss vom 21.2.2025 â 1 BvR 2267/23 â Ăberspannung der Darlegungsanforderungen im Beschwerdeverfahren gegen die Nichtzulassung der Revision    Â
- 347. BVerwG, Urteil vom 5.12.2024 â 2 C 7.24 â ErmĂ€chtigungsgrundlage zur Annullierung eines Teils einer beamtenrechtlichen LaufbahnprĂŒfung    Â
- 349. SĂ€chsOVG, Beschluss vom 19.3.2024 â 6 B 104/23 â UnzuverlĂ€ssigkeit wegen VerstöĂen gegen waffenrechtliche Auflagen    Â
- 350. SĂ€chsOVG, Beschluss vom 25.9.2024 â 6 E 62/23 â Durchsuchungs- und Beschlagnahmeanordnung; Anordnungsadressat; Hintermann    Â
- 351. SĂ€chsOVG, Beschluss vom 3.4.2024 â 4 A 222/23 â Frist zur Einberufung des Gemeinderats    Â
- 352. SĂ€chsOVG, Beschluss vom 7.10.2024 â 4 A 233/23 â Anspruch auf Beantwortung einer Anfrage eines Gemeinderats    Â
- 354. SĂ€chsOVG, NK-Urteil vom 16.1.2025 â 3 C 85/21 â Normenkontrolle bezĂŒglich der SĂ€chsischen Corona-Schutz- Verordnung vom 19. Oktober 2021 Â Â Â Â
- 355. SĂ€chsOVG, Urteil vom 27.8.2024 â 4 A 125/21 â Antrag auf Zugang zu Umweltinformationen; Missbrauch    Â
- 356. OVG Rheinl.-Pf., Beschluss vom 10.12.2024 â 1 A 10844/24.OVG â ZulĂ€ssigkeit grenznaher Bebauung    Â
- 362. OVG Rheinl. Pf., Urteil vom 16.1.2025 â 1 A 10241/22.OVG â Immissionsschutzrechtliche Genehmigung einer Offroad-Anlage im AuĂenbereich; Sachbescheidungsinteresse    Â
- 365. BVerwG, Urteil vom 18.12.2024 â 6 C 13.22 â Reichweite der wasserhaushaltsrechtlichen Unterhaltungslast des Bundes als EigentĂŒmer der BundeswasserstraĂen    Â
- 366. SĂ€chsOVG, Beschluss vom 11.10.2024 â 1 A 317/23 â Kein Anspruch auf Aufrechterhaltung oder Schaffung öffentlicher StraĂen    Â
- 367. HambOVG, Beschluss vom 3.2.2025 â 3 Bs 145/24 â Abschleppen eines verkehrswidrig geparkten Fahrzeugs in einer Parkraumbewirtschaftungszone    Â
- 368. BVerwG, Urteil vom 19.12.2024 â 1 C 3.24 â Beurteilung der allgemeinen abschiebungsrelevanten Lage fĂŒr alleinerziehende Elternteile mit Grundschulkind und Kind unter drei Jahren in Italien    Â
- 369. SĂ€chsOVG, Beschluss vom 14.10.2024 â 4 A 303/23.A â Abschiebungsandrohung; Familienmitglieder im Asylverfahren    Â
- 370. HambOVG, Beschluss vom 9.1.2025 â 5 Bf 64/23.Z â Feststellung der Staatenlosigkeit; Mitwirkung als Dolmetscher und SachverstĂ€ndiger    Â
- 375. BVerwG, NK-Urteil vom 7.11.2024 â 3 CN 2.23 â VerkĂŒrzung von Schonzeiten fĂŒr Schalenwild zum Schutz von Schutzwald    Â
- 376. BVerwG, Urteil vom 14.11.2024 â 5 C 7.23 â EntschĂ€digung wegen unangemessener Dauer eines personalvertretungsrechtlichen Beschlussverfahrens    Â
- 377. BVerwG, NK-Urteil vom 11.12.2025 â 8 CN 2.23 â Antragsfrist des § 47 Abs. 2 Satz 1 VwGO bei Ănderung der angegriffenen Vorschrift    Â
- 378. OVG Rheinl.-Pf., Beschluss vom 15.1.2025 â 8 C 10880/23.OVG â Streitwertfestsetzung; AnhörungsrĂŒge    Â
- 380. VGH BW, Beschluss vom 28.2.2025 â A 13 S 959/24 â Terminsverlegung wegen Urlaubsabwesenheit eines Einzelanwalts
-
   Â